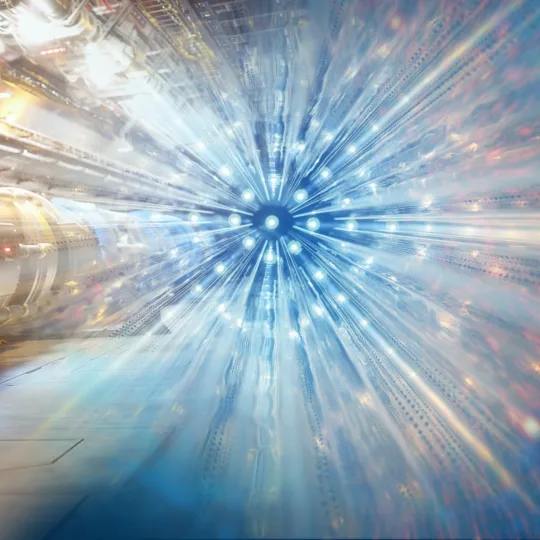Wie gut kennen wir die Kompetenzen von geflüchteten Menschen?
Der Bundesrat will die beruflichen und schulischen Fähigkeiten von Geflüchteten in der Schweiz gezielter erfassen und besser nutzen. Ziel ist es, ihre Integration in den Arbeitsmarkt zu verbessern und langfristig Kosten – zum Beispiel in der Sozialhilfe – zu senken. Ein Bericht zeigt auf, welche Daten zu Ausbildung und Arbeitsmarktfähigkeit von Geflüchteten bereits vorliegen und wo noch Lücken bestehen.

Im Dezember 2024 hat der Bundesrat einen umfassenden Bericht zur Datengrundlage über die Kompetenzen von Geflüchteten veröffentlicht. Der vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) koordinierte Bericht wurde in Zusammenarbeit mit verschiedenen Bundesstellen und kantonalen Konferenzen erarbeitet. Anlass war ein parlamentarischer Vorstoss der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (Postulat 22.3393), insbesondere vor dem Hintergrund der vielen Geflüchteten aus der Ukraine mit Schutzstatus S. Die zentrale Frage lautete: Wie können die individuellen Potenziale von geflüchteten Menschen frühzeitig erkannt und genutzt werden – zur Förderung ihrer Integration und als Antwort auf den Fachkräftemangel?
Was wird unter «Kompetenzen» verstanden?
Der Bericht definiert Kompetenzen als Bildungsstand (z.B. Bildungsabschlüsse) und Bildungspotenzial, Berufserfahrung sowie das Potenzial zur Integration in den Arbeitsmarkt. Nach der Zuweisung der geflüchteten Menschen in die Kantone erheben die zuständigen Stellen persönliche Daten, um individuelle Integrationspläne zu erstellen. Diese Daten fliessen in aggregierter Form in das Monitoring der «Integrationsagenda Schweiz» (IAS) ein. Zurzeit läuft ein Pilotprojekt des Staatssekretariates für Migration (SEM) in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik (BFS) zur besseren Nutzung dieser Daten.
Integration durch reguläre Bildungs- und Arbeitsstrukturen
Ein besonderes Augenmerk legt der Bericht auf den Zugang der Geflüchteten zu den sogenannten «Regelstrukturen», das heisst zu den regulären Bildungsinstitutionen und Arbeitsmarktinstrumenten. Dazu gehören Berufsfachschulen, Universitäten, Stellen zur Anerkennung ausländischer Diplome, regionale Arbeitsvermittlungsstellen (RAV) oder die Sozialhilfe. Auch in diesen Bereichen fallen persönliche Daten an, die punktuell in die öffentliche Statistik einfliessen. Der Bericht analysiert zudem bestehende statistische Systeme wie ZEMIS (Migrationsdaten), die Integrationsindikatoren, die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE), das Strukturerhebungsmodul oder die Bildungsstatistik, um Hinweise auf die Kompetenzen von Geflüchteten zu erhalten.
Junge Geflüchtete auf dem Bildungsweg
Kurz vor Abschluss des Berichts hat das BFS eine Studie zu den Bildungsverläufen von jungen Geflüchteten im Alter von 16 bis 25 Jahren veröffentlicht. Sie basiert auf den LABB-Daten (Längsschnittanalysen zu Bildungsbiografien), ZEMIS und der Bevölkerungsstatistik STATPOP. Die Ergebnisse zeigen: Immer mehr junge Geflüchtete beginnen eine nachobligatorische Ausbildung – oft über Brückenangebote. Insbesondere junge Frauen sind untervertreten, oft aufgrund familiärer Verpflichtungen.
Rund 60 Prozent der jungen Geflüchteten in Ausbildung streben eine zweijährige Ausbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) an – etwa im Detailhandel, in der Pflegeassistenz oder im Gebäudetechnikbereich. Die Erfolgsquote liegt bei rund 86 Prozent – fast gleich hoch wie bei Jugendlichen, die in der Schweiz zur Schule gegangen sind. Die IAS hat zum Ziel, dass fünf Jahre nach der Einreise zwei Drittel der 16- bis 25-Jährigen eine Ausbildung absolvieren. Dieses Ziel ist noch nicht erreicht: Bei der Kohorte 2012 lag die Quote bei 32 Prozent, 2017 bereits bei 52 Prozent.
Anzahl bei einem RAV gemeldeter Personen aus dem Asylbereich (Stand Februar 2025)
| Aufenthaltsstatus von Personen im Asylbereich | Anzahl bei einem RAV gemeldete Stellensuchende | Anzahl Nichterwerbstätige im erwerbsfähigen Alter (18‒64) | Anteil bei einem RAV gemeldete Stellensuchende an Nichterwerbstätigen im erwerbsfähigen Alter (18‒64) |
|---|---|---|---|
| B (anerkannte Flüchtlinge) | 1545 | 24'391 | 6,3 % |
| F (vorläufig aufgenommene Flüchtlinge und Ausländer) | 1842 | 17'181 | 10,7 % |
| S (Schutzbedürftige) | 2678 | 29'255 | 9,2 % |
| N (Asylsuchende) | 70 | 11'142 | 0,6 % |
| Total | 6135 | 81'969 | 7,5 % |
Quelle: SECO
Zwischen Schutzstatus und Arbeitsmarkt
Je nach Aufenthaltsstatus können Geflüchtete einer Erwerbstätigkeit nachgehen – entweder durch ein Meldeverfahren oder mit vorgängiger Bewilligung. Die Kantone erfassen dabei unter anderem den Tätigkeitsbereich. Diese Informationen fliessen teilweise in das nationale Informationssystem ZEMIS ein. Über das SECO-Portal EasyGov können Arbeitgebende solche Meldungen digital einreichen. Beim Schutzstatus S liegt die Erwerbstätigenquote derzeit bei rund 31 Prozent. Der Bundesrat strebt jedoch eine Quote von 40 Prozent an. Arbeitsfähige Personen werden von den Sozialdiensten den RAV gemeldet – auch wenn sie keine Arbeitslosenentschädigung beziehen. Die RAV sammeln dabei Informationen über Ausbildung und Berufserfahrung, erfassen aber nur einen kleinen Teil der Geflüchteten (ca. 5–10 Prozent).
Fazit: Viel Potenzial, aber noch Luft nach oben
Der Bundesratsbericht zieht ein erstes Fazit: Die Schweiz verfügt über zahlreiche Datenquellen zur Bildung und Integration von Geflüchteten – allerdings sind diese oft fragmentiert und werden wenig systematisch ausgewertet. Insbesondere fehlt ein Gesamtbild über die tatsächlichen Qualifikationen und beruflichen Kompetenzen. Vor diesem Hintergrund hat das SEM angekündigt, in den kommenden Jahren einen Integrationsbericht zu erarbeiten. Dieser soll vertieft analysieren, wie sich die gesellschaftliche und berufliche Integration der geflüchteten Bevölkerung entwickelt – und wie Politik und Praxis gezielter darauf reagieren können.
Aufnahme und Integration von Personen mit Schutzstatus S: Meilensteine
11. März 2022
Der Bundesrat aktiviert den Schutzstatus S für Menschen aus der Ukraine ab 12. März 2022.
1. März 2023
Jugendliche aus der Ukraine sollen eine Lehre in der Schweiz abschliessen können.
1. November 2023
Der Bundesrat beschliesst, dass 40 Prozent der erwerbsfähigen Personen mit Status S bis Ende 2024 einer Arbeit nachgehen sollen.
8. Mai 2024
Der Bundesrat stärkt Arbeitsmarktintegration von Personen mit Status S, insbesondere durch die Ernennung eines Beauftragten für Arbeitsmarktintegration, der den Kontakt mit den Unternehmen stärken soll.
20. Juni 2024
Erste nationale Impulstagung zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten.
4. September 2024
Der Bundesrat verlängert das Programm S zum dritten Mal bis zum 4. März 2026.
26. Februar 2025
Der Bundesrat eröffnet eine Vernehmlassung zu einer Vorlage zur Förderung der Erwerbstätigkeit von Personen mit Schutzstatus S sowie von in der Schweiz ausgebildeten Drittstaatsangehörigen.
Entwicklung des Programms Unterstützungsmassnahmen für Personen mit Schutzstatus S des Bundes.
Kontakt
Autor/in