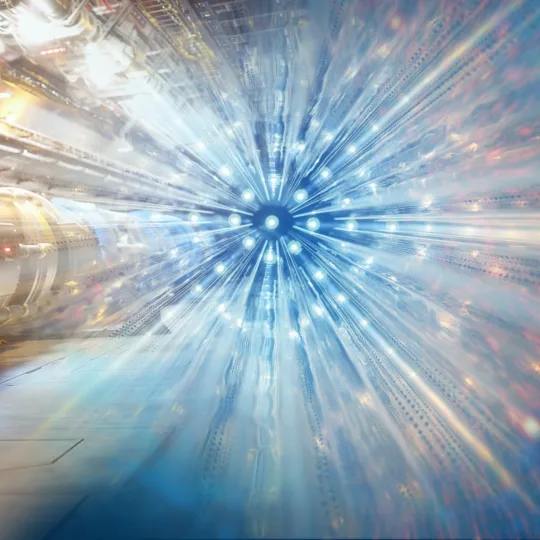Die Europäische Weltraumorganisation ESA wird 50
Die ESA feiert 2025 ihr 50-jähriges Bestehen. Sie blickt auf zahlreiche Erfolge zurück und wappnet sich für eine herausfordernde Zukunft. Dank der ESA ist Europa heute ein globaler Leader in der Raumfahrt. Die Schweiz als Gründungsmitglied trägt dazu bei und profitiert davon.

Zehn Gründerstaaten haben 1975 die Konvention der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) unterzeichnet und damit den Grundstein für die europäische Erfolgsgeschichte im Weltraum gelegt. Die Schweiz war als Gründungsmitglied von Anfang an «on Board» und betreibt bis heute den Grossteil ihrer Raumfahrtaktivitäten über die ESA.
Wir können stolz auf die Errungenschaften sein, die wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern erreicht haben. In den letzten 50 Jahren hat die ESA zahlreiche Momente erlebt, die mit «Freude herrscht» (so Bundesrat Adolf Ogi 1992 in einer Live-Verbindung zur internationalen Raumstation ISS an die Adresse von Claude Nicollier, dem ersten Schweizer im Weltall) beschrieben werden können.
Eine vollständige Liste dieser Erfolge würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, aber einige herausragende Leistungen möchte ich dennoch erwähnen. Dank der Vision der Gründerstaaten der Organisation besitzt Europa heute einen autonomen Zugang zum Weltraum mit der Ariane-Rakete (in ihrer 6. Generation) und der Vega C. Die ESA hat im Alleingang oder in Zusammenarbeit mit Partnern wie der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA praktisch alle Planeten unseres Sonnensystems erkundet. Sie ist 2005 auf dem Saturn-Mond Titan und 2014 spektakulär auf dem Kometen Tschurjumow-Gerassimenko gelandet und ist derzeit unterwegs zum Merkur und Jupiter. Auch unser Alltag ist von der ESA geprägt, in dem wir täglich von der ESA entwickelte Systeme und darauf basierende Daten nutzen, sei es in der Meteorologie, der Umweltbeobachtung, der Telekommunikation oder der Navigation.
Wir könnten auch anders fragen: Wo wären Europa und die Schweiz heute ohne die ESA? Vermutlich wären wir heute nicht unter den globalen Leadern der Raumfahrt und wir würden, wie in anderen technologisch innovativen Bereichen, eine starke Fragmentierung der Aktivitäten in Europa erleben. Im Bereich der Forschung wäre die Abhängigkeit von einigen wenigen nationalen Raumfahrtagenturen gross, und unsere Industrie könnte wohl nicht mit Spitzenprodukten trumpfen. Das ESA-Modell, das einerseits die Wettbewerbsfähigkeit der Wissenschaft und Industrie fördert, und andererseits den heute 23 Mitgliedsländern einen Rückfluss garantiert, hat sich bewährt. In der Schweiz hat es dazu geführt, dass sich ein Ökosystem mit mehreren hundert Akteuren aus Forschung und Industrie gebildet hat. Diese liefern einzigartige Beiträge an die Programme der ESA, wie zum Beispiel wissenschaftliche Instrumente oder Bestandteile von Raketen. Von dieser Zusammenarbeit profitiert die Schweiz in wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. Denn Raumfahrt schafft Wohlstand.
Doch bei aller Festlaune: Zurücklehnen geht nicht! Für die Zukunft zeichnen sich grosse Herausforderungen ab. Die Raumfahrt wächst schnell und wird kostengünstiger. Die technologische Entwicklung schreitet rasant voran. Der globale Wettbewerb wird stärker. Ich denke, dass in den kommenden 50 Jahren Menschen den Mars betreten werden und vielleicht auch dauerhaft auf dem Mond leben und arbeiten. Es ist wahrscheinlich, dass wir Anzeichen des Lebens auf anderen Planeten entdecken, vielleicht sogar in unserem Sonnensystem.
Für die ESA gibt die sogenannte «Strategie 2040» den Weg für die Zukunft vor. Sie legt den Fokus auf Autonomie, Resilienz, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Das soll nicht nur der Erkundung des Universums dienen, sondern auch dem Schutz der Erde, des uns bisher einzigen bekannten bewohnbaren Planeten. Die nächsten 50 Jahre versprechen ebenso spannend zu werden wie die vergangenen fünf Jahrzehnte. Dank der ESA will die Schweiz auch in Zukunft vorne – bzw. räumlich gesprochen: - weit oben – mit dabei sein.