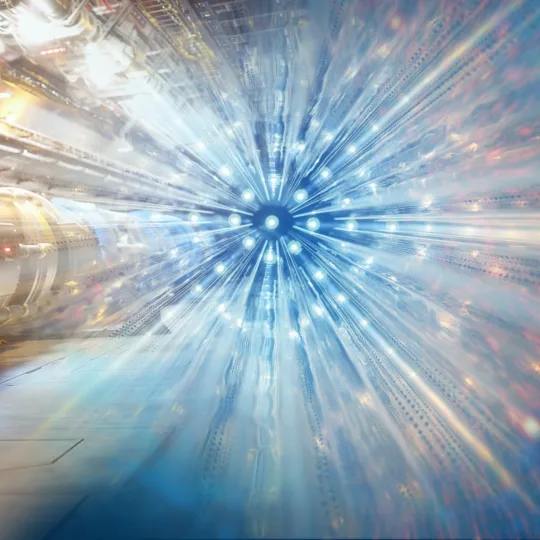Die Vorzüge des Multilateralismus in der Forschung am Beispiel von ITER
Die Grenzen von Wissenschaft und Technologie zu erweitern, um die Herausforderungen von morgen zu lösen, erfordert mitunter gemeinsames Handeln ‒ denn manche Vorhaben übersteigen die Möglichkeiten einzelner Nationen. Der Bau des thermonuklearen Reaktors ITER illustriert die Vorteile multilateraler Zusammenarbeit in Forschung und Innovation. Die Schweiz nimmt ihre Beteiligung an dieser Forschungsinfrastruktur am 1. Januar 2026 wieder auf.

Die Nutzung der Kernfusion gilt als eine der grossen strategischen Schlüsselaufgaben unserer Zeit. Mit einem nahezu unbegrenzt verfügbaren Brennstoff, dem Fehlen langlebiger radioaktiver Abfälle und einem von Natur aus sicheren Reaktorkonzept verspricht die Kernfusion eine saubere und verlässliche Energiequelle für eine moderne Gesellschaft, die ihren CO₂-Fussabdruck verringern möchte.
Die Bedingungen nachzubilden, wie sie im Innern der Sterne herrschen, bleibt jedoch eine gewaltige wissenschaftliche und technologische Herausforderung – ein Thema, das ganz oben auf der Agenda der führenden Industrienationen steht. Unter ihnen haben sich die Europäische Union, China, Südkorea, Indien, Japan, Russland und die USA 2006 zur ITER Organization (IO) zusammengeschlossen, um den International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) zu errichten. Diese aussergewöhnliche Forschungsinfrastruktur soll zeigen, dass die Kernfusion auf industriellem Niveau realisierbar ist.
Ressourcenbündelung und Mehrwert des Multilaterismus
Auf dem 42 Hektar grossen Gelände im französischen Cadarache arbeiten täglich rund 5000 Menschen am Bau der ITER-Infrastruktur. Mit einem Durchmesser von 30 Metern und einem Gewicht von 23'000 Tonnen wird der Tokamak-Reaktor des ITER der grösste jemals konstruierte seiner Art und eine der komplexesten Maschinen überhaupt sein. Die ersten wissenschaftlichen Ergebnisse werden für das Jahr 2034 erwartet.
Die gemeinsame Finanzierung einer solch gewaltigen Forschungsinfrastruktur ist ein naheliegender Grund für die Einrichtung einer internationalen multilateralen Organisation. Doch dies ist nicht der einzige Vorteil: Der Multilateralismus ermöglicht es, die Expertise und Produktionskapazitäten der Mitgliedstaaten gezielt für ein gemeinsames Projekt einzusetzen. Umgekehrt fördert er die Verbreitung neuen Wissens und neuer Kompetenzen in allen beteiligten Staaten. So werden beispielsweise die supraleitenden Kabel des ITER von verschiedenen Mitgliedstaaten hergestellt, um die Entwicklung zukunftsweisender Industriezweige zu stimulieren. Auf diese Weise erzeugt ITER bereits heute technologische und industrielle Impulse in allen beteiligten Ländern.
Gemeinsame Werte als Grundlage internationaler Zusammenarbeit
Multilateralismus ermöglicht nicht nur die Bewältigung wissenschaftlicher und technologischer Herausforderungen, sondern vernetzt auch die politischen und wissenschaftlichen Agenden von Nationen mit teilweise unterschiedlichen Interessen. Er eröffnet Möglichkeiten, die Zukunft auf der Grundlage geteilter Werte und Prinzipien gemeinsam zu gestalten. Multilaterale Institutionen stehen für eine Governance, die auf ausgehandelten Regeln statt auf Machtverhältnissen beruht. Internationale Forschungsorganisationen werden so zu wirkungsvollen Instrumenten der Wissenschaftsdiplomatie.
Die Schweiz im Zentrum des Multilateralismus
Als Gaststaat und Mitglied zahlreicher internationaler Organisationen ist die Schweiz ein engagierter Akteur des Multilateralismus ‒ besonders in den Bereichen Forschung und Innovation. Dank ihrer langjährigen diplomatischen Tradition und herausragenden wissenschaftlichen Expertise beherbergt die Schweiz seit 1954 gemeinsam mit Frankreich das CERN und wirkt in führenden internationalen Forschungsorganisationen mit. Bereits in den 1960er-Jahren engagierte sich die Schweiz in der Kernfusionsforschung und schloss 1978 ein Kooperationsabkommen mit der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom), das sie vollständig in das gemeinsame europäische Forschungsprogramm zur Kernfusion einband. Diese Zusammenarbeit ebnete den Weg für die schrittweise Integration der schweizerischen Forschung in europäische Netzwerke, bis hin zur vollständigen Teilnahme an den EU-Rahmenprogrammen ab 2004.
Wiederaufnahme der Schweizer Beteiligung ab 2026
2007 beschloss die Schweiz, sich als Mitglied des gemeinsamen europäischen Unternehmens Fusion for Energy (F4E) am ITER-Projekt zu beteiligen. Zwischen 2007 und 2020 leistete die Schweiz einen substanziellen Beitrag zum Bau von ITER, unter anderem durch die Einbindung ihrer Forschungsinstitutionen und Unternehmen in Bereiche wie Kryotechnik, Mechanik, Energieversorgung, Heiztechnologien oder Diagnosesysteme. In meinem Austausch mit dem Generaldirektor der IO, Pietro Barabaschi, wurde deutlich, wie bedauerlich die Unterbrechung der Schweizer Beteiligung zwischen 2021 und 2024 war und wie sehr die Rückkehr der Schweiz ins ITER-Projekt erwartet wird.
Dank der Unterzeichnung des Abkommens über die Teilnahme der Schweiz an den EU-Programmen (EUPA) am 10. November 2025 wird die Schweiz ihre Beteiligung an ITER als Mitglied von F4E ab dem 1. Januar 2026 wieder aufnehmen. Gleichzeitig wird sie als assoziierter Drittstaat Zugang zu den Programmen Horizon Europe und Digital Europe sowie zum Forschungs- und Ausbildungsprogramm von Euratom erhalten – allesamt zentrale multilaterale Instrumente, um gemeinsam mit unseren europäischen und, im Fall von ITER, auch aussereuropäischen Partnern die wissenschaftliche und technologische Zukunft unserer Gesellschaften zu gestalten.